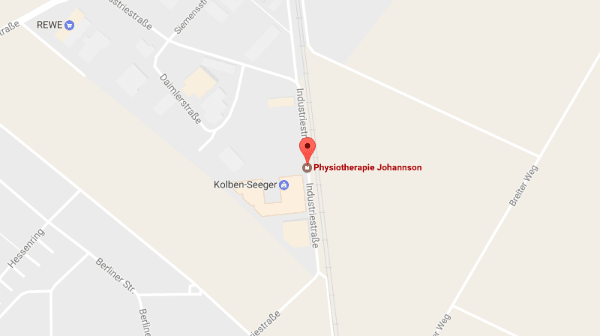Frozen Shoulder? Impingement? Wir bringen Bewegung zurück.
Eiszeit in der Schulter? - So taut die Bewegung wieder auf
Schulterschmerzen zählen zu den häufigsten orthopädischen Beschwerden in der physiotherapeutischen Praxis. Sie können verschiedene Ursachen haben und reichen von akuten Reizzuständen über chronische Überlastungssyndrome bis hin zu strukturellen Verletzungen. Symptome wie Schulterschmerzen bei Bewegung, Nachtschmerz oder Einschränkungen im Alltag sind oft ähnlich. Umso wichtiger ist es, die Ursachen zu verstehen, die richtige Therapie einzuleiten und realistische Erwartungen an den Verlauf zu haben.
Frozen Shoulder (Adhäsive Kapsulitis)
Diese Form der Schulterschmerzen ist besonders heimtückisch: Sie beginnt oft schleichend mit Bewegungsschmerz, der sich zunehmend in eine massive Bewegungseinschränkung ohne strukturelle Verletzung entwickelt. Die Ursache liegt in einer Entzündung und anschließenden Schrumpfung der Gelenkkapsel. Es gibt drei typische Phasen: Einfrieren (Schmerzphase), Gefroren (Bewegungseinschränkung) und Auftauen (langsame Erholung). Bildgebend ist nicht immer ein Schaden sichtbar [1, 2, 3].
Impingement-Syndrom
Lange wurde angenommen, dass Schulterschmerzen v. a. durch eine Enge unter dem Schulterdach entstehen, dem sogenannten Impingement. Heute weiß man, dass nicht der Raum allein, sondern ein gestörtes Zusammenspiel zwischen Schulterblatt, Oberarm und Rotatorenmanschette für die Schulterschmerzen verantwortlich ist. Der Begriff 'Impingement' beschreibt daher eher ein Symptomkomplex, kein konkretes Krankheitsbild [4, 5, 6, 7].
Rotatorenmanschetten-Verletzungen
Hier liegt ein struktureller Schaden an einer oder mehreren Sehnen der Schultermuskulatur vor, häufig Supraspinatus oder Subscapularis. Die Beschwerden entstehen durch Risse, Teilrisse oder degenerative Reizzustände. Die Symptome können denen eines Impingements ähneln. Ein MRT kann hilfreich sein, um das Ausmaß der Verletzung zu bestimmen – ist aber nicht immer entscheidend für die physiotherapeutische Behandlung [8, 9]. Manchmal sind solche Verletzungen auch der Beginn einer sekundären Frozen Shoulder.
Warum die Schulter so besonders ist
Das Schultergelenk hat im Vergleich zur Hüfte eine extrem flache Gelenkpfanne. Diese Bewegungsfreiheit macht es zugleich instabil. Die Stabilität wird daher nicht durch Knochen, sondern fast ausschließlich durch Muskeln und Sehnen – die sogenannte Rotatorenmanschette – gesichert. Haltungsprobleme, Überkopfarbeiten, Stressspannungen (z. B. im Subscapularis) und eine eingeschränkte Halswirbelsäulenbeweglichkeit beeinflussen das Gelenk stärker als bei anderen Körperregionen [10, 11, 12].
Phasen der Frozen Shoulder (adhäsive Kapsulitis)
Die Frozen Shoulder verläuft typischerweise in drei aufeinanderfolgenden Stadien, die jeweils eigene Schwerpunkte in der Behandlung erfordern:
I. Freezing-Phase (Entzündungs- und Schmerzphase)
Diese erste Phase beginnt schleichend mit zunehmenden Schulterschmerzen, insbesondere bei Bewegung oder in der Nacht. Die Schmerzen entstehen durch eine Entzündungsreaktion der Gelenkkapsel, die zu einer Reizung der Nervenfasern und beginnender Verklebung des Gewebes führt. In diesem Stadium ist die Beweglichkeit oft noch weitgehend erhalten, wird jedoch zunehmend schmerzhafter.
>Physiotherapie in dieser Phase zielt darauf ab, durch gezielte, nicht reizende Mobilisationen sowie physikalische Maßnahmen (z. B. Wärme, Ultraschall oder Elektrotherapie) den Entzündungsreiz zu reduzieren, die Durchblutung zu fördern und den Stoffwechsel zu aktivieren, ohne das Gewebe zusätzlich zu belasten.
II. Frozen-Phase (Einsteifung und Bewegungseinschränkung)
In dieser Phase nehmen die Schulterschmerzen allmählich ab, jedoch wird die Bewegung der Schulter deutlich eingeschränkt. Die Gelenkkapsel ist nun verkürzt und verhärtet, was zu einem „mechanischen Block“ in alle Bewegungsrichtungen führt.
> Die Physiotherapie konzentriert sich hier auf dosierte Mobilisationen, um die Struktur wieder zu dehnen und eine Überlastung zu vermeiden. Gleichzeitig werden sekundäre Schäden durch Immobilisation, wie Muskelabbau und Haltungsveränderungen, durch gezielte Übungen frühzeitig verhindert.
III. Thawing-Phase (Auftauphase und Wiedergewinnung der Beweglichkeit)
Hier verbessert sich die Beweglichkeit der Schulter wieder spürbar. Die Schulterschmerzen sind deutlich reduziert, die Kapsel beginnt sich zu lösen.
> Die Physiotherapie zielt nun auf den aktiven funktionellen Wiederaufbau, also die gezielte Kräftigung und Koordination der Schulter, um dauerhafte Bewegungseinschränkungen zu vermeiden und den Patienten schrittweise zurück in den Alltag zu begleiten.
Ursachen der Frozen Shoulder
Die Frozen Shoulder tritt häufiger auf, als viele denken – etwa 2–5 % der Bevölkerung sind im Laufe ihres Lebens betroffen. Sie tritt vor allem bei Menschen zwischen 40 und 60 Jahren auf und betrifft Frauen etwas häufiger als Männer.
Man unterscheidet zwei Formen:
- Primäre Frozen Shoulder: Die Ursache ist unbekannt. Sie entsteht ohne klaren Auslöser, oft im Zusammenhang mit hormonellen Veränderungen, Stress oder Stoffwechselstörungen.
- Sekundäre Frozen Shoulder: Tritt infolge anderer Erkrankungen oder Verletzungen auf – zum Beispiel nach Brüchen, Operationen, längerer Ruhigstellung (z. B. durch eine Armschlinge) oder bei aktiver Arthrose. Auch Erkrankungen wie Diabetes, Schilddrüsenunterfunktionen oder ein metabolisches Syndrom erhöhen das Risiko.
In beiden Formen ist eine Störung des lokalen Zellstoffwechsels ein zentraler Faktor: Durch die Minderdurchblutung und mangelnde Bewegung wird das Gewebe unterversorgt, was zu Verklebungen, Entzündungen und Schmerzen führt.
Die Physiotherapie setzt hier gezielt an: Wärmeanwendungen, manuelle Techniken, Ultraschall, Elektrotherapie und bewegungsorientierte Maßnahmen fördern die Mikrozirkulation, bauen Stoffwechselendprodukte ab und unterstützen den Körper dabei, wieder in einen gesunden Zustand zurückzufinden – ganz ohne Überlastung.
Unsere physiotherapeutische Herangehensweise und Diagnostik
Am Beginn jeder Behandlung steht eine umfassende Anamnese, in der wir nicht nur Ihre aktuellen Beschwerden, sondern auch Ihre Vorgeschichte, beruflichen Belastungen, Schlafverhalten und Alltagsanforderungen einbeziehen. Uns ist es wichtig, den Menschen als Ganzes zu verstehen, mit all seinen individuellen Voraussetzungen und Zielen.
Daran anschließend erfolgt eine strukturierte funktionelle Untersuchung:
- Wir überprüfen das Bewegungsausmaß der Schulter sowohl aktiv als auch passiv und dokumentieren dieses systematisch, um den Verlauf transparent nachvollziehen zu können.
- Über Krafttests, sowohl isometrisch als auch dynamisch, gewinnen wir ein genaues Bild über den Zustand einzelner Muskelgruppen, so können Rotatorenmanschettenverletzungen oder auch eine Frozen Shoulder besser eingegrenzt werden.
- Wir beurteilen die Schmerzlokalisation und -qualität, führen funktionelle Alltagstests durch (z. B. das Greifen in den Nacken oder das Anziehen eines Mantels) und nutzen gezielte Mobilisationstests, um die Beweglichkeit der Gelenke genauer einzuordnen.
- Wenn vorhanden, beziehen wir bildgebende Befunde (z. B. MRT oder Röntgen) mit ein – auch wenn diese die funktionelle Einschätzung in der physiotherapeutischen Praxis nicht ersetzen können.
Basierend auf diesen Erkenntnissen entwickeln wir einen individuellen Therapieplan, der folgende Schwerpunkte enthalten kann:
- Kapselmobilisationen und spezielle Gelenktechniken, um eingeschränkte Strukturen gezielt zu lösen,
- die Lösung myofaszialer Schutzspannungen, insbesondere im Bereich von Subscapularis, Pectoralis und Bizepssehne,
- eine gezielte Haltungsschulung sowie Beratung zur Arbeitsplatzergonomie,
- ein systematisches Krafttraining mit Hypertrophie-Fokus, abgestimmt auf die jeweilige Phase der Erkrankung,
- und die Integration von Halswirbelsäule und Thorax, da deren Beweglichkeit einen erheblichen Einfluss auf die Schulterfunktion hat.
Durch diese ganzheitlich orientierte Herangehensweise innerhalb der Schulterschmerzen Physiotherapie schaffen wir die Grundlage für eine nachhaltige Verbesserung der Beschwerden bei Frozen Shoulder/Rotatorenmanschettenverletzungen oder auch Impingement – individuell abgestimmt und fachlich fundiert.
Behandlungsdauer und realistische Erwartungen
Viele Patient*innen wünschen sich schnelle Ergebnisse. In der Realität benötigt die Schulter Zeit: Bei strukturellen Einschränkungen wie Frozen Shoulder oder nach Sehnenverletzungen muss mit einem Behandlungszeitraum von 6 bis 12 Monaten gerechnet werden. Entscheidend ist nicht nur die Therapie, sondern auch das regelmäßige eigenständige Training. Studien zeigen, dass die Kombination aus Physiotherapie und Training langfristig erfolgreicher ist als passive Therapien allein [13, 14].
Fazit
Schulterschmerzen sind komplex, aber fast immer therapierbar. Entscheidend ist das richtige Verständnis der Ursache, eine individuelle und aktive Therapie und die Bereitschaft zur Mitarbeit. Bei uns erhalten Sie genau das: fundierte Diagnostik, gezielte Therapie, realistische Planung.
Haben Sie Fragen oder möchten Sie sich beraten lassen? Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin bei uns.
Literaturverzeichnis
[1 AWMF-Leitlinie] AWMF-Leitlinie 033/052: https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/033-052
[2 UpToDate] UpToDate
[3 Physiotutors] Physiotutors: https://www.physiotutors.com/frozen-shoulder-treatment
[4 BJSM] British Journal of Sports Medicine: https://bjsm.bmj.com/content/54/5/279
[5 JOSPT] JOSPT Clinical Practice Guidelines, 2022: https://www.jospt.org/
[6 PubMed 19841837] PubMed 19841837: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19841837
[7 PubMed 33503234] PMID 33503234: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33503234
[8 PMC4827371] PMC4827371: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4827371
[9 PubMed 31227142] PMID 31227142: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31227142
[10 JOSPT] JOSPT 2023: https://www.jospt.org/
[11 PubMed 32434365] PMID 32434365: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32434365
[12 PubMed 34547191] PMID 34547191: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34547191
[13 Cochrane] Cochrane Database 2021: https://www.cochranelibrary.com/
[14 PubMed 34723412] PMID 34723412: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34723412/